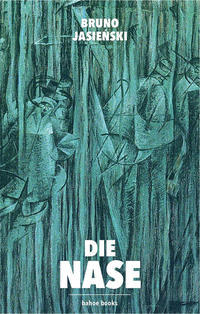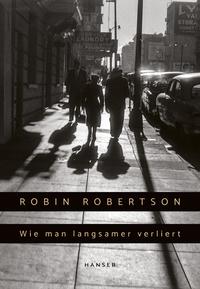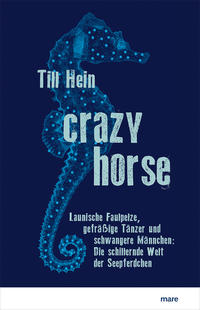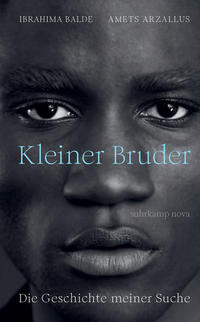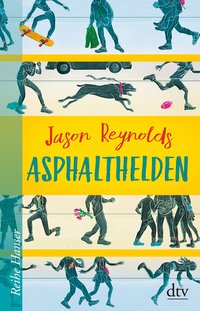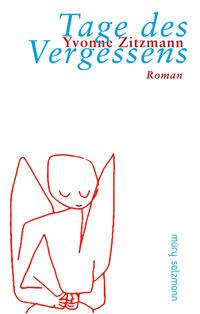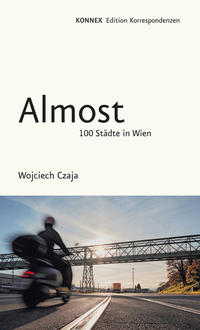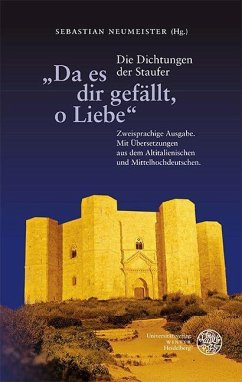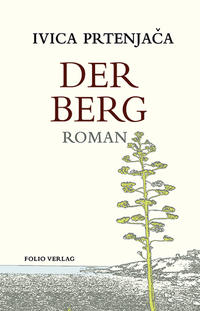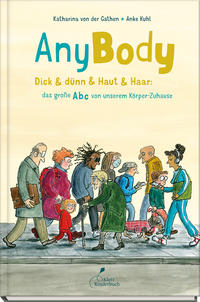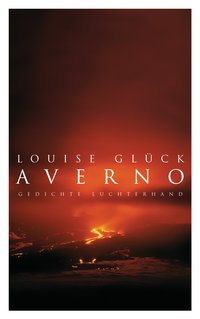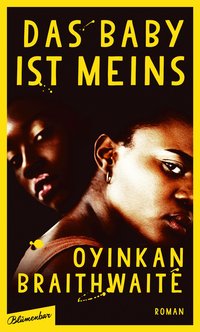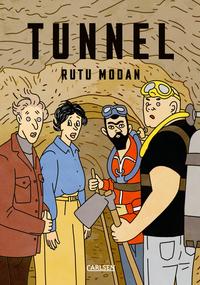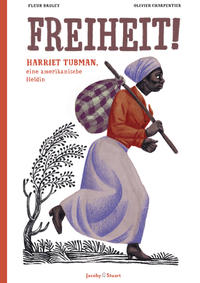Wauter Mannaert
Yasmina und die Kartoffelkrise
Yasmina gehört zu den Büchern, die Kinder und Erwachsene mit Gewinn und Lust lesen und anschauen und darin sehr Verschiedenes erkennen können. Der Comic liefert dabei eine kritische Analyse unserer Konsumgesellschaft. Moral ist hier durchaus ein Thema, verliert sich aber nicht in belehrenden Exkursen, sondern bleibt nah an der sympathischen Heldin. Und das ist die Schülerin Yasmina – ein Energiebündel mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Ganz in der Tradition der frankobelgischen Comic-Helden sehen wir sie in den immer gleichen Kleidern – ein bewährtes Mittel zur Identifikation mit der Protagonistin. Unter der großen Kochmütze kommen zwei energische Zöpfe hervor, Schürze und Kochkittel verweisen keineswegs auf ein traditionelles Rollenklischee, sondern unterstreichen die Entschlossenheit, mit der Yasmina die Welt zu verbessern gedenkt – mit gutem, gesundem Essen.
Dass die Zukunft auch von der Tatkraft der jungen Generation abhängt, wird in der Figur des Vaters anschaulich. Er arbeitet in einer Pommesbude, jeden Abend zieht Frittenduft durch das Mietshaus (visuell wunderbar eingefangen). Das mit ungesundem Essen verdiente Geld reicht kaum zum Leben. Also hilft Yasmina nicht nur mit selbst organisiertem Gemüse aus, sondern macht damit dem Vater auch noch köstliche vegetarische Pausensnacks, die seine übergewichtigen Kollegen wiederum nur mit Kopfschütteln begutachten.
Konditionierter Geschmack, so könnte man die These des Buches formulieren, macht uns Menschen zu Pawlowschen Hunden. Der belgische Zeichner Wauter Mannaert aber hat kein illustriertes Manifest erschaffen, sondern einen Ökothriller, der sich mit großer Lust auch der Mittel des Genres bedient. Der Bösewicht (Tom de Perre) ist wirklich böse, und sein Plan, die Menschheit durch Geschmack zu manipulieren, wäre einem Gegenspieler James Bonds würdig.
Entsprechend abwechslungsreich sind auch die Szenarien, die Mannaert entwirft: der alternative Gemüsegarten, die furchteinflößende Fabrik, in der die Kartoffeln genmanipuliert werden, Yasminas Wohnhaus mit dem geheimnisvollen Dachgarten. Immer wieder gibt es seitenlange Passagen, die mit wenig oder gar keinem Text auskommen; ein Augenschmaus, möchte man hier unbedingt sagen. Das gilt besonders für die ganzseitigen Bilder, an denen man sich kaum satt sehen kann. Der klassische Ligne-Claire Stil eines Hergé ist vor allem im gut unterscheidbaren Personal durchaus erkennbar. Aber Mannaert öffnet die Bilder, und das nicht nur durch den Verzicht auf Bildrahmen. Die Darstellung der Verwandlung von Menschen und Tieren durch manipulierte Nahrung inszeniert er virtuos in Slapstick Manier.
Das große, temporeiche Abenteuer von Yasmina ist für Kinder ab 10 empfehlenswert, die Rezepte im Anhang sind zwar anspruchsvoll, aber man sollte sie unbedingt probieren.
Jakob Hoffmann, Frankfurt