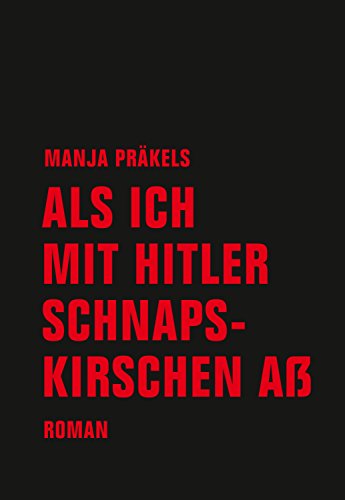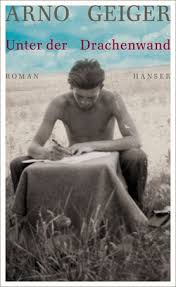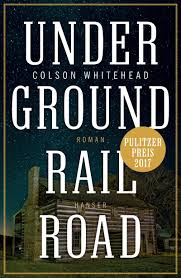Die Haushaltshilfe des Vaters ruft an, er ist gestorben. Gerade mal vier Wochen später kommt der Anruf aus dem Altersheim, in dem die Mutter die letzten Jahre verbrachte. Überraschend ist auch sie gestorben.
Beim Sichten der Hinterlassenschaften findet der Sohn Fotos, tauchen Erinnerungen auf. Scheinbar distanziert, fast kriminologisch genau schaut er zurück und betrachtet die Spuren des Lebens dieses einstmals so schönen Paares.
Seine Betroffenheit wird deutlich in der Beharrlichkeit, mit der er der Geschichte seiner Eltern nachgeht. Ihre Liebesgeschichte hatte trotz des Krieges verheißungsvoll begonnen. Aber dann hatten sich die Eltern bald, nachdem sie in den Westen gekommen waren, getrennt. Er, der Junge, war bei Georg, dem Vater, geblieben. Die Mutter, Herta, war von einem Tag auf den anderen verschwunden. Wann hatte das Unglück angefangen? 1956 nach dem Aufstand in Ungarn hatten die Eltern beschlossen, in den Westen zu gehen, solange es noch ging, und alles Erreichte, Freunde und Familie zu verlassen, um noch einmal von vorne zu beginnen. Während Georg vorausfuhr, setzte Herta das Ersparte in eine Kamera um. Denn die könne man bestimmt im Westen gut wieder verkaufen, so zumindest der Plan.
Der Neubeginn war schwierig. Und der Verkauf der Ostkamera im Westen stellte sich als unmöglich heraus. Um Herta zu demonstrieren, dass sie keinen Fehler gemacht hatte, der Kauf der Kamera doch richtig gewesen war, „lieh“ Georg sich, heimlich, wie er sich wohl dachte, das Geld von seiner Firma. Nun war die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten.
Der Vater wurde zwar in der Öffentlichkeit rehabilitiert. Aber Georg und Herta waren, um sich gegenseitig zu schützen, beide aus Liebe schuldig geworden. Gleichzeitig aber hatten sie sich damit auch der gegenseitigen Verachtung ausgesetzt. So konnten sie nicht mehr zusammenleben, konnten sich nur noch trennen. Und wie lebt es sich ohne den geliebten Menschen? Die Geschichte des schönen Paares ist eine Geschichte über den Verlust der Vorstellung eines möglichen Gelingens.
Gert Loschütz beschreibt hier akribisch die sichtbare Oberfläche eines funktionierenden Alltags, auf der sich die Strudel im Untergrund doch abzeichnen. Der Roman bezieht seine Spannung aus der Tiefenwahrnehmung und ihrer Spiegelung an der Oberfläche sowie ihrer Darstellung in einer genauen und schnörkellosen Sprache. Meisterhaft!
Mation Victor, Frankfurt am Main