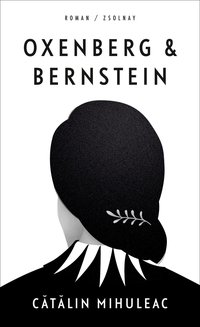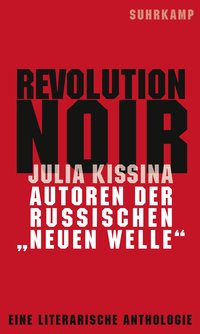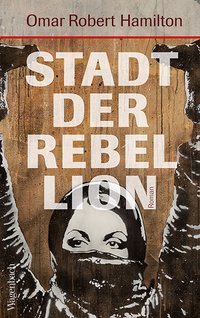Ayelet Gundar-Gosehn – Lügnerin
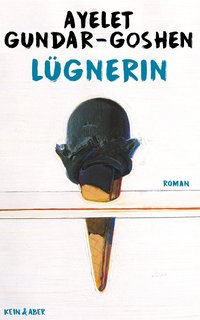
978-3-0369-5766-1
Ayelet Gundar-Goshen versteht es, eine pure, herrliche Sommerlektüre zu schreiben, die zugleich klug und erhellend in aktuelle Debatten eingreift.
Ort und Zeit des Geschehens: Tel Aviv, die letzten Wochen der Sommerferien. Die Hitze steht in den Straßen, die junge sommersprossige Nuphar eilt zu ihrem Ferienjob in die Eisdiele. Sie ist mit ihren 17 Jahren noch so uneins mit sich und ihrem Körper, wie man es nur sein kann, wenn man den Schönheitsidealen permanent ausgesetzt ist, ihnen aber nicht entspricht. Da ist ihre vom Glück geküsste jüngere Schwester Maya, der alles mühelos zufliegt, da sind Mutter und Vater und der Junge Lavie, den sie zu lieben beginnt – und schließlich die alte Raymonde, die im Seniorenheim lebt. Zwischen diesen beiden Polen, der alten Raymonde und der jungen Nuphar, spannt Gundar-Goshen ihre Geschichte auf.
Die junge und die alte Frau verstricken sich unabhängig voneinander und eher zufällig in eine Lügengeschichte, die sie befreit und ihnen eine Stimme verleiht. Endlich werden sie gehört, endlich wird ihnen Aufmerksamkeit geschenkt. Dass das just in dem Moment geschieht, als sie nicht von sich erzählen, sondern sich die Geschichten anderer einverleiben, zeigt das moralische Dilemma der Figuren, das überaus erhellend beschrieben und amüsant erzählt wird.
Im Fall der jungen Nuphar ist es die erfundene Vergewaltigung – der abgehalfterte Medienstar Avishai Milner fährt der jungen unscheinbaren Eisverkäuferin Nuphar dermaßen überheblich über den Mund, dass sie weinend und schreiend in den Hinterhof flieht. Die zufällig vorbeikommenden Polizisten hören das Mädchen, folgen den Schreien und stellen ihm Fragen, auf die Nuphar kaum mit einem Nicken antworten muss – und sofort wird sie als das Opfer angesehen, wird im Polizeipräsidium befragt, in Talkshows eingeladen, wird für ihren Mut gelobt und endlich wahrgenommen.
Im Fall der alten Raymonde handelt es sich um eine Lüge, die schwerer wiegt, denn Raymondes Lüge hat das Zeug, die Leiden eines ganzen Volkes zu verhöhnen. Als ihre Mitbewohnerin, eine Schoah-Überlebende, stirbt, schlüpft sie im wahrsten Sinne des Wortes in deren Kleider und erzählt statt ihrer von den Schrecken in den Konzentrationslagern.
Es ist ein wirkliches Glanzstück, das Gundar-Goshen gelingt, denn in keiner Sekunde werden die Leiden der wirklichen Opfer in Frage gestellt oder entwürdigt – im Fall der alten Raymonde erscheint es sogar als Ehre und Auszeichnung, das Leben der Freundin weiterzuführen, und als eine historische Notwendigkeit, als lebender Zeuge den Besuchern der Gedenkstätten erzählen zu können. Im Fall der jungen Nuphar ist der me-too-Ruf der Umweg, den sie gehen muss, um sich selbst anzunehmen. Endlich blüht sie auf und passt in die Kleider der strahlenden jüngeren Schwester. Auf diese Weise erzählt Gundar-Goshen, wie sprachliche Strukturen und Erzählmuster zur Befreiung für die Individuen und vom Individuum werden können. Aber: Lügen darf man nicht!
Ines Lauffer, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt