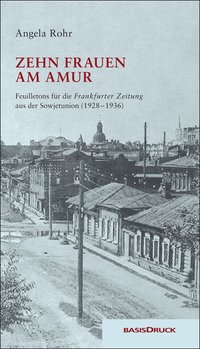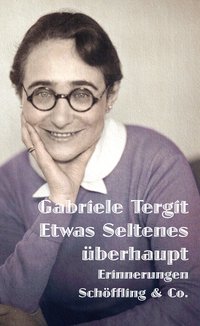Francesca Melandri – Alle, außer mir
Roman. Aus dem Italienischen von Esther Hansen

978-3-8031-3296-3
Motor der Geschichte ist der italienische Kolonialismus, genauer, Mussolinis Eroberungsfeldzug in Äthiopien, der 1935 begann und fünf Jahre währte. Sangue giusto, Richtiges Blut, heißt der Roman im Italienischen und verweist damit schon im Titel auf den faschistischen Rassenwahn und das System strikter Rassentrennung, das das Regime in Äthiopien installierte. Bis zu zehn Prozent der Bevölkerung fielen diesem Krieg zum Opfer, den Hungerlagern, Massenhinrichtungen und Senfgaseinsätzen. Von einem „vergessenen Völkermord“ spricht der Historiker Aram Mattioli – vergessen, weil ins Abseits der Erinnerungskultur Italiens geschoben, wo nie eine glaubwürdige Aufarbeitung der Vergangenheit stattgefunden hat. Die an der Bevölkerung verübten Gewalttaten der deutschen Besatzer ab 1943 überschatteten die Tätervergangenheit des Landes, es konnte sich fortan als Opfer sehen oder als antifaschistische Partisanen gegen die deutsche Besatzung. So überdauerte bis heute in weiten Teilen der Bevölkerung ein unvollständiges und allzu nachsichtiges Bild des Faschismus. Francesca Melandri destruiert dieses Bild in ihrem Roman radikal. „Italien war ein ausgenüchterter Alkoholiker, der wie jeder Verfechter der Abstinenz nichts von seinem Verhalten während des letzten schlimmen Rausches wissen will“, schreibt die römische Autorin, die als Drehbuchautorin und Dokumentarfilmerin bekannt wurde und nun ihren dritten Roman vorlegt, nach Eva schläft, einem Roman über die Zwangsitalianisierung Südtirols, und Über Meereshöhe, dessen Thema der italienische Terrorismus ist.
Die Handlung setzt ein im Jahr 2010, noch regiert Berlusconi. Ilaria Profeti, Mitte vierzig, Lehrerin und kinderlos, eine der Hauptfiguren des Romans, ist eine mehr oder weniger typische Vertreterin des linksliberalen Milieus in Italien: Desillusioniert durch die fortwährende Untergrabung der Demokratie durch die rechte Regierung, ist sie gleichwohl als Lehrerin noch immer sehr engagiert. Alle außer ihr sind korrupt, bigott und unmoralisch. Was sie nicht daran hindert, eine – verheimlichte – sexuelle Beziehung zu Piero einzugehen, einem Jugendfreund aus vermögender Familie, der in Berlusconis Partei Karriere gemacht hat und damit politisch genau das Gegenteil ihrer Überzeugungen vertritt. Ilaria glaubt, ihr Leben im Griff zu haben, ihre Familie zu kennen. Bis etwas geschieht, das sie in ihrer Grundfesten erschüttert: Eines Abends , Ilaria kommt vom römischen Alltag abgekämpft nach Hause, sitzt auf der Treppe ihrer Wohnung im sechsten Stock eines Miethauses ein abgerissener junger Mann, dem Aussehen nach ein Äthiopier, eindeutig ein Geflüchteter; wie sich herausstellt, ein regimekritischer junger Lehrer, der, um sich der Verfolgung durch das postkoloniale Regime zu entziehen, „raus musste“ und nach jahrelanger Flucht durch die Wüste und libysche Lager in Italien landete, wo sein Asylantrag binnen weniger Minuten abgelehnt wurde. Und dieser junge Mann, der nun illegal in Land lebt, erklärt Ilaria in perfektem Italienisch: „Ich heiße Shimeta Ietmgeta Attilioprofeti“. Der Beweis: sein Pass. Ietmgeta sei der Name seines verstorbenen Vaters, Attilio Profetis Sohn. Attilio Profeti, das ist Ilarias Vater. Ein Vater, den sie liebt. Der einst der heranwachsenden Ilaria beichtete, er habe noch eine zweite Familie, eine Frau, Anita, die er nach der Scheidung von Ilarias Mutter heiratet, und einen Sohn namens Attilio, nach dem Vater benannt . Die Erzählung nimmt Fahrt auf. Den hochbetagten Vater kann Ilaria nicht mehr befragen. Er ist dement. Die Suche nach der Wahrheit hinter der Behauptung des Jungen, sie sei seine Tante, führt Ilaria zurück in die italienische Provinz zur Zeit des Faschismus, zur Herkunft ihres Vaters, und weiter über Rom nach Äthiopien. Denn der Vater hatte mehr zu verbergen als eine zweite Familie: Er, der vorgegeben hatte, Partisan gewesen zu sein, entpuppt sich als überzeugter Faschist, der sich freiwillig für den Abessinien-Feldzug meldete, als Assistent eines Rassenforschers arbeitete, an Feldzügen und Massakern teilnahm und in Äthiopien einen Sohn zeugte, den er nie anerkannte. Attilio Profeti ist eine der wichtigsten Figuren der Erzählung, charmant, liebenswert, skrupellos, vielschichtig gezeichnet, glaubwürdig, so wie andere Handlungsträger auch. Flankiert werden sie von zahlreichen Nebenfiguren, die leider öfter zu Schablonen geraten sind. Die Stofffülle ist immens, doch der Autorin ist es gelungen, die Zeitsprünge, den häufigen Wechsel der Perspektiven und Schauplätzen in den einzelnen Erzählsträngen stimmig ineinander zu binden.
Zehn Jahre hat Francesca Melandri an diesem Roman gearbeitet, in Archiven geforscht und in Äthiopien Orte der Handlung aufgesucht, dort nach noch lebenden Zeitzeugen gesucht. Einprägsam sind viele Szenen, etwa der Angriff auf widerständige Äthiopier, die mit Senfgas aus ihrem Felsenversteck getrieben und getötet werden. Fast schon satirisch die Beschreibung von Gaddafis berühmten Besuch in Rom, der die Stadt in einen Ausnahmezustand versetzte. Gleichwohl seien manche stilistische Entgleisungen erwähnt, etwa wenn es heißt, “die Hochebene des Wollo und des Shoa” seien “so ausgetrocknet wie die Knie von Hundertjährigen”. Auch die Übersetzung hätte bisweilen ein sorgfältigeres Lektorat verdient. Das ist schade, keine Frage. Aber es ändert nichts daran, dass Francesca Melandri ein weiterer Roman gelungen ist, dessen Stärke darin liegt, historisch fundiert zu entwickeln, warum das heutige Italien ist, wie es ist.
Michaela Wunderle, Frankfurt am Main



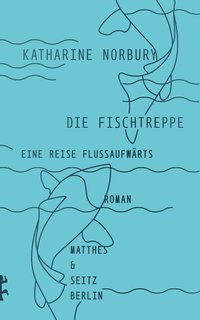
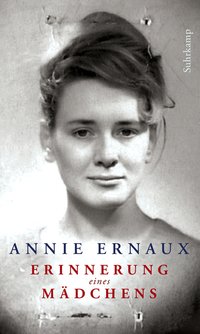



 Mit Zaal Andronikashvili und Ruthard Stäblein
Mit Zaal Andronikashvili und Ruthard Stäblein