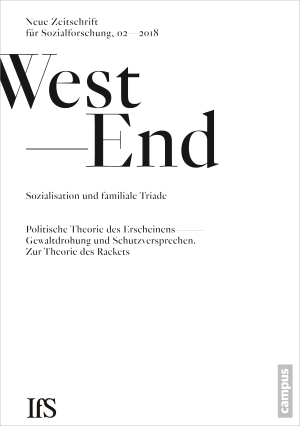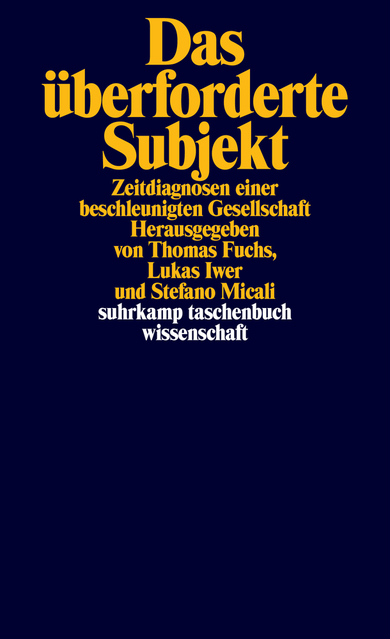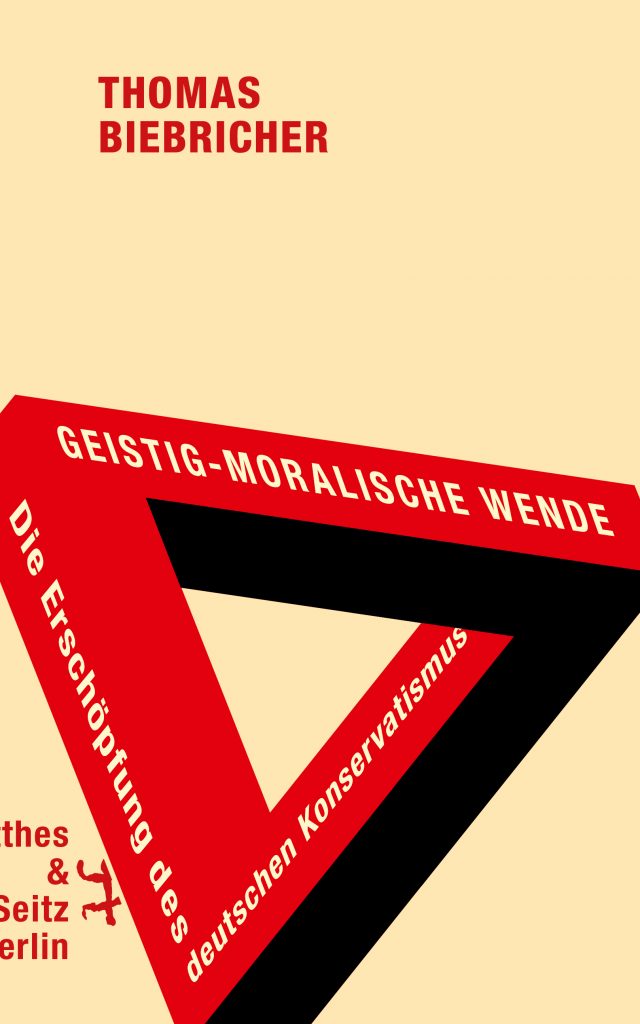Fragen an Europa von Gesine Grotrian
Was lieben wir? Was fürchten wir? Illustriert von Susan Schädlich. Ab 12 Jahre
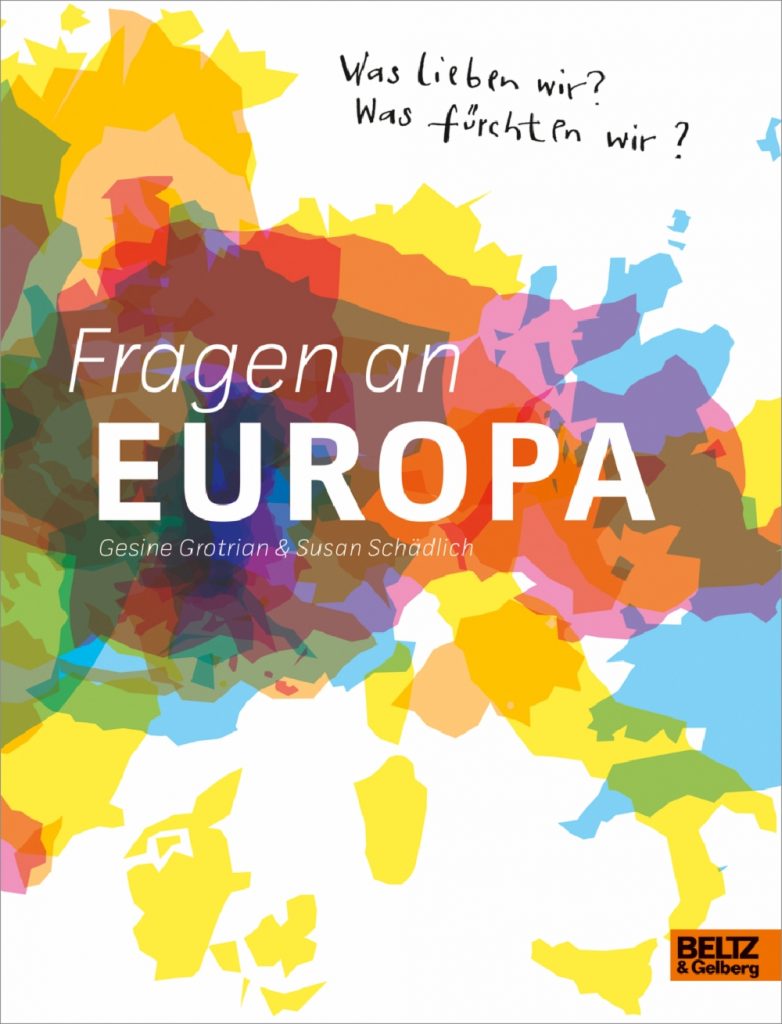
978-3-407-81245-2
Europa! Alle sprechen immer darüber, doch was ist das eigentlich? Was versuchen wir da eigentlich immer vor Populismus und Nationalismus zu schützen? Natürlich ist Europa der Kontinent, auf dem wir leben, keine Frage, doch ist Europa nicht noch viel mehr? Steht dieser Kontinent, dieser Zusammenschluss der Länder, nicht auch für Frieden, Gleichheit und Menschenrechte? Und was wissen wir eigentlich über die EU? Klar, irgendwie bestimmt die EU unseren Alltag, doch die meisten Menschen wissen nicht wie. All diese Fragen und noch einige mehr werden in dem Buch Fragen an Europa geklärt. Man wird mit einigen Grundinformationen, die auch schon sehr interessant sind, in das Buch eingeführt. Weißt du zum Beispiel, wie viele Menschen in Europa leben und wie viele Sprachen in Europa gesprochen werden? Und ist dir eigentlich klar, dass es nicht nur eine, sondern viele verschiedene Definitionen von Europa gibt?
Das Buch kommt mit 60 Fragen an und über Europa daher. Einige sind eher allgemein gehalten, zum Besipiel was eigentlich Populismus oder Pluralismus sind, andere sind sehr spezifisch auf Europa bezogen, wie zum Beispiel, welche besonderen Zugstrecken durch Europa verlaufen. Alles wird mit Hilfe sehr einfacher und doch aufschlussreicher Schaubilder illustriert, die sehr nett gestaltet sind, wie bei Frage 32: „Wer hatte die Idee für die EU? Meilensteine in Bildern“. Die Absicht des Buches ist es, junge Menschen zum Nachdenken über Europa anzuregen, und laut den Autoren hat man das Buch nur dann wirklich verstanden, wenn man mit mehr Fragen aus dem Leseerlebnis herausgeht als man vorher hatte. Ihr Wunsch ist es natürlich, dass Menschen durch dieses Buch Europa lieben lernen, wie sie es tun, da es offensichtlich viele Menschen gibt, die vergessen haben, was wir an Europa eigentlich haben.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da es ein für mich sehr interessantes Thema vorstellt. Außerdem gehen die Autorinnen auf einen der wichtigsten Punkte ein, die für ein funktionierendes Europa eigentlich nötig und die Gegenbewegung zum Rechtsruck in Europa wäre: Pluralismus! Er ist wahrscheinlich eine der wenigen Chancen, die wir noch gegen den Gedanken des Nationalstaates haben. Also lasst uns diese ergreifen, um dem fortschreitendem Populismus die Stirn zu bieten. Anfangen sollten wir damit, uns gut über Europa und die EU zu informieren und Möglichkeiten zur positiven Veränderung zu entwerfen. Genau dafür ist dieses Buch perfekt.
Vicco Siebicke, 15 Jahre