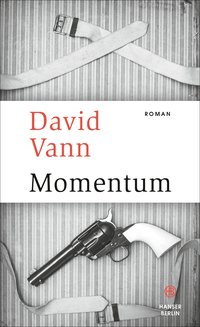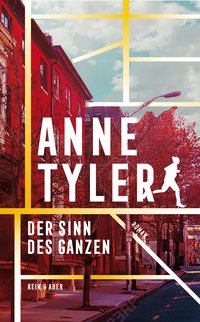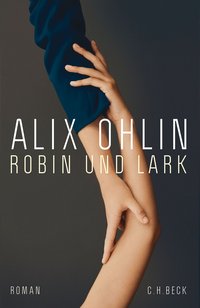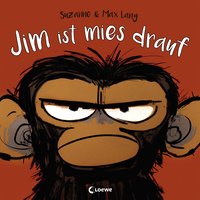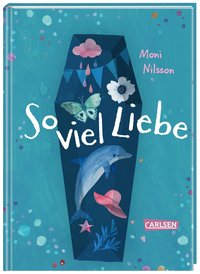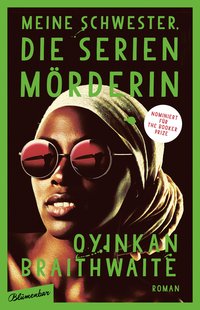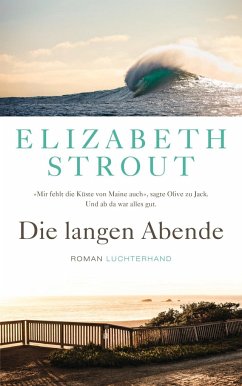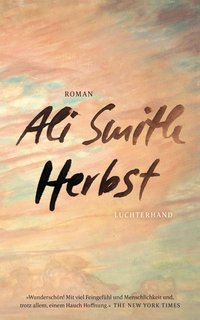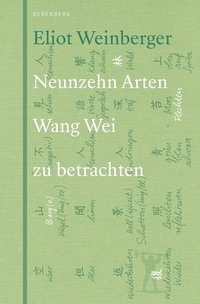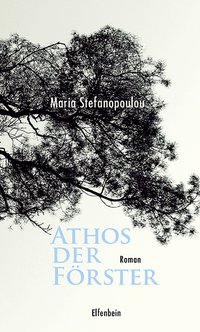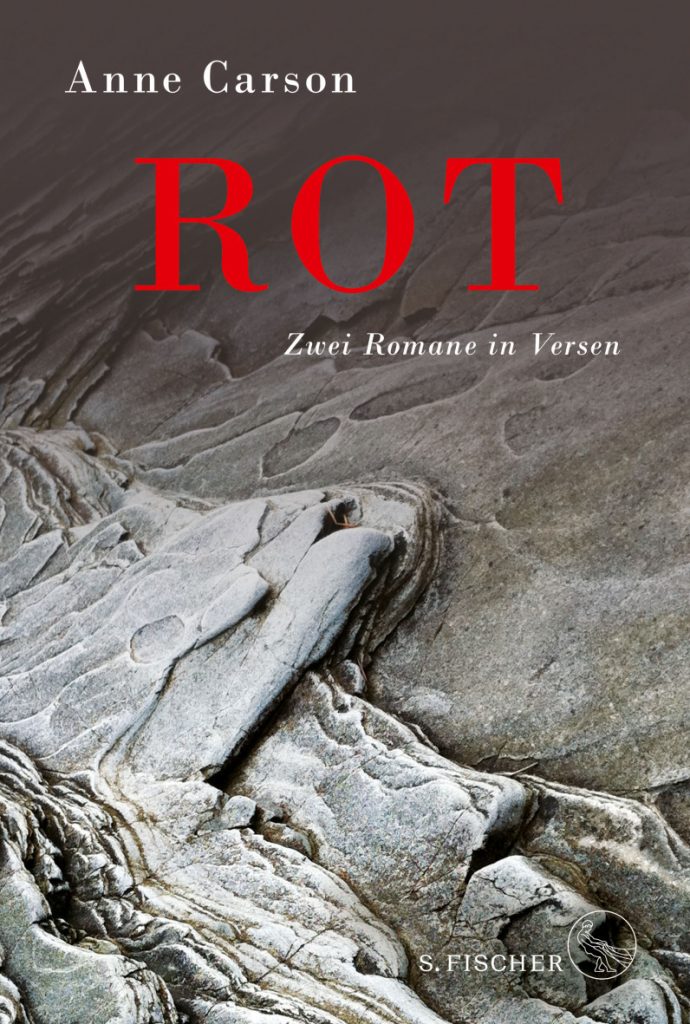auf kommbuch.com
Buchempfehlungen
Anke Kuhl
Manno!

16 €
ab 7 Jahren
Manno – und A Mänafa Mitleid. Die Kindheit ist die Zeit, in der man sehr vieles zum ersten Mal macht. Die Zeit, in der man beginnt, Dinge zu verstehen, dann auch zu durchschauen. Das geht einher mit Erfahrungen. Solche Erfahrungen stellen sich oft mit bestimmten Ereignissen ein – und die sind nicht immer angenehm. Das merkt man selbst Jahre später, wenn man meist lächelnd davon erzählt. In Manno geht es um diese Ereignisse, ihre immense Größe aus Sicht der Betroffenen und das Lachen aus unserer heutigen Sicht. Das ist keine Schadenfreude (obwohl Anke Kuhl zusammen mit ihrem Mann Martin auch darüber ein schönes Buch geschrieben hat), sondern ein ganz grundlegendes Mitfühlen.
In Manno erinnert sich Anke Kuhl an ihre Kindheit in den 70ern. Badezimmer sind grün gefliest, die Hosen des Vaters haben Schlag, und die Frisur der Mutter ist erschaffen aus Lockenwicklern und Trockenhaube. Im Mittelpunkt der Episoden stehen Anke und ihre Schwester Eva. Sie lieben ihre Eltern und sie lieben Openom, das sind Opa und Oma, „sie gehören so sehr zusammen, dass wir ihnen einen gemeinsamen Namen gegeben haben“. Es ist eine Kindheit voller Dramen. Mal ist es ein aggressives Karnickel, dass dem Hasenvater die Nase abbeißt, dann ein falsch aufgenähtes Freischwimmerabzeichen, der Streit der Eltern genau so wie die Explosion der Sonne und diese Schwester, die ihr Eis immer viel schneller isst und dann das eigene bedroht. In einer kleinen Geschichte, ganz am Ende, hören die Mädchen mit dem Vater im Auto einen Schlager, in dem der „Schöne Schmerz“ besungen wird – so kann man es auch sagen. So viel Drama, so viel Liebe ist in dieser Kindheit. Keinen Zweifel lässt die Autorin daran, dass es die schönste, die geborgenste Kindheit ist, die man sich nur vorstellen kann.
Anke Kuhl ist für ihre Kinderbücher bekannt. Zum zweiten Mal (nach „Lehmriese lebt“) erzählt die Frankfurter Künstlerin nun ihre Geschichte in der Form eines Comics. Das ist eine sehr glückliche Entscheidung. Es erlaubt ihr die perfekte Variation des Tempos, Gedanken über das Ende des Universums werden im Bett gedacht, da geht es um Statik, Schutz, Dunkelheit. Aber das Gefecht um die Lieblingsunterhose, das zwischen den beiden Schwestern mit zwei Klobürsten ausgetragen wird, braucht Raum und Dynamik. Die Texte besitzen das gleiche, genaue Timing, manchmal geht es auch ohne Worte, zum Beispiel beim alltäglichen Drama um eine rutschende Strumpfhose. Die aquarellierten Zeichnungen schließlich sind unübertroffen. Der „Mänafa Mitleid“ kommt direkt aus einem ABBA Song. „Gimme Gimme Gimme“ in der lautmalerischen Sprache der Kinder nachzulesen, ist schon sehr lustig – die Choreografie, die die Schwestern hier mit zwei Freundinnen dazu erfinden, treibt einem die Tränen des Glücks in die Augen.
Manno ist ein Buch für alle, und man braucht es so sehr wie eine gute Kindheit.
Jakob Hoffmann, Frankfurt
Kübra Gümüsay
Sprache und Sein
Die Sprache, in der wir aufwachsen, formt unser Denken, bestimmt, was wir benennen können, gibt vor, welche Gefühle wir ausdrücken und welche Lebensbereiche kulturell relevant sind, denn nur dann werden in einer Sprache dafür überhaupt Ausdrucksmöglichkeiten geschaffen. Wir sehen nicht, wir fühlen und wissen nicht, was alles außerhalb unseres Denkrahmens denkbar wäre.
Mit Sprache und Sein stellt uns Kübra Gümüşay den Blick der Mehrsprachigen zur Verfügung. Sie ist eine Autorin, die nicht nur zwischen Lyrik und Prosa wechselt, sondern sich nach ihrer Muttersprache, dem Türkischen, auch das Deutsche und Englische so zu eigen gemacht hat, dass sie darin all das zum Ausdruck bringen kann, was ihr wichtig ist. Die Erfahrung, dass sich manche Begriffe nicht übersetzen lassen, weil weder Wörterbücher noch Online-Übersetzer Bedeutungen und semantische Feinheiten abbilden können, haben vermutlich die meisten von uns schon mal gemacht. Und dass ein Wort nur selten ein Wort ohne unscharfe Randbereiche ist, in dem sich durch Kontext oder Betonung Untertöne mit transportieren lassen, wissen wir nicht erst, seitdem wir auch gesellschaftlich wieder über die Verrohung und Entgrenzung von Sprache diskutieren müssen.
Kübra Gümüşay denkt über Sprache und Sprechen nach, wendet sich aber auch dem Sagbaren zu, also Themen, die aus einer tabuisierten Grauzone des Unausgesprochenen langsam ans Licht kommen „Das Internet hat neue Perspektiven aus der Stille zur Sprache gebracht.“ Digitale Diskursräume ermöglichen es Betroffenen, überhaupt Worte zu finden, zum Beispiel für sexualisierte Gewalt im Rahmen der #MeToo-Bewegung. Dass Harvey Weinstein in der vergangenen Woche zu 23 Jahren Haft verurteilt wurde, ist auch als Sieg der Sprache zu sehen, des Ausgesprochenen über das Schweigen. Zeitgleich müssen wir uns mit einer Enthemmung und Entgrenzung der Sprache auseinandersetzen, also dem Gegenteil des reflektierten Schweigens. Das Totschlagargument rechtsgerichteter und fremdenfeindlicher Gesprächspartner ist häufig, „man könne hier ja nicht mal seine Meinung offen äußern“, wenn es um eine vermeintliche Bedrohung durch unterschiedliche Kulturen oder Religionen geht. Michel Friedman sagte hierzu in einem Radio-Interview kurz nach dem Anschlag in Hanau, dass die gesellschaftliche Vereinbarung, nicht alles und sofort auszusprechen, was uns durch den Kopf geht, einen wichtigen Namen trägt, nämlich: Zivilisation. Es gilt heute also mehr denn je, umsichtig abzuwägen, in welchen Bereichen zu viel und in welchen zu wenig gesagt wird.
In Sprache und Sein schult die Autorin darüber hinaus unsere Wahrnehmung der Ent-Individualisierung von Mitmenschen anderer Herkunft. Sie trägt Beispiele aus eigener Erfahrung und denen anderer kulturell oder politisch aktiver Musliminnen dafür zusammen, wie stark sie als „Kopftuchträgerin“ oder als junge Frau mit Migrationshintergrund wahrgenommen werden und wie selten als Person. Journalist*innen befragen sie als muslimische Frau, anhand derer zu verstehen versucht wird, wie alle anderen funktionieren. „Und jedes Exemplar der Spezies Muslim*innen ist wie das andere. Ob jung, alt, queer, weiß, schwarz, of Color, mit oder ohne Behinderung, geflüchtet, Arbeiter*innen, Akademiker*innen – sie alle werden ihrer Stimme und Sichtbarkeit beraubt.“
Unsere kultur- und sprachbedingte Klassifizierung der Welt in Schubladen und Stereotype gilt es wahrzunehmen, aufzubrechen und bestenfalls abzulegen. Kübra Gümüşay veröffentlicht hierzu nicht nur regelmäßig Kolumnen (https://kubragumusay.com/kolumnen/), sondern hat mit wachem und kenntnisreichen Blick ein wichtiges und unbedingt lesenswertes Buch geschrieben!
Larissa Siebicke, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt
Ali Smith
Herbst
Was ist nicht schon alles über Ali Smiths Roman Herbst gesagt worden: Er sei ein Brexit-Roman, ein Roman über die Pop-Künstlerin Pauline Boty, über die Profumo-Affäre und Christine Keeler. Aber Ali Smiths Herbst ist vor allem eines: Ein unglaublich gut geschriebener Roman, der uns vor Augen führt, warum wir die Literatur so sehr lieben. Nicht, weil sie uns Fakten liefert, nicht, weil sie uns nochmals abbildet, was wir in der sogenannten Wirklichkeit bereits erlebt und vielleicht auch schon wieder vergessen haben, sondern weil sie die unangefochtene Künstlerin der Fiktion ist, weil sie fabulieren kann, weil sie eine phantastische Künstlerin ist. Gerade noch tot am Ufer angeschwemmt, rennt Daniel Gluck wie ein junger Gott ins Gebüsch und versteckt sich zwischen den Blättern, ist selbst entzückt und beglückt, auf einmal wieder ein Knabe zu sein (diese „hübschen, jungen Füße“), ein andermal steckt er in einer schottischen Kiefer fest und ist auch darüber beglückt, es hätte ja auch eine Zwergkonifere sein können. Aber wer ist jetzt Daniel Gluck?
Wer will, der kann die Geschichte also auch so lesen: Elisabeth Demand, eine Kunsthistorikerin mit Lehrauftrag um die 30, besucht ihren ehemaligen Nachbarn und Freund, den knapp 100-jährigen Daniel Gluck, im Krankenhaus. Wann immer sie ihn besucht, schläft er. Daniel wird für Elisabeth nicht mehr aufwachen. Er schwebt zwischen Leben und Tod. Und von diesem Punkt an bekommen wir die ungewöhnliche Freundschaft der beiden erzählt. Elizabeth Demand ist 9 Jahre alt, als ihre Mutter den 80-jährigen Nachbarn Daniel Gluck fragt, ob er auf ihre kleine Tochter aufpassen kann. Aber Elisabeth geht bald auch gerne zu ihm, wenn die Mutter zu Hause ist. Denn anders als ihre alleinerziehende Mutter hat er Zeit, ihr die Welt zu zeigen, und das heißt bei Mr. Gluck: die Welt zu sehen, zu hinterfragen, was man sieht, es nochmals zu wenden und anders zu sehen, nochmals neu zu erzählen. Als die beiden einmal Spazieren gehen, erfinden sie ein neues Spiel, Bagatelle, in dem es ums Geschichtenerfinden geht: „Wer sind die handelnden Personen? … Ein Mann mit einer Waffe, sagte Elisabeth. Okay, sagte Daniel. Ich entscheide mich für jemanden, der in Gestalt eines Baumes auftritt. Eines was?, sagte Elisabeth. Auf keinen Fall. Sie müssen so was sagen wie noch ein Mann mit noch einer Waffe. Warum muss ich?, sagte Daniel.“
Mitten in der Konjunktur der Memoireliteratur, des
autofiktionalen Schreibens, das mit dieser Volte natürlich die
Authentizität zwar steigert, aber ohne sich ihrerseits tatsächlich aus
dem Reich der Fiktionen zu verabschieden, ist es ein beinahe unbändiger
Genuss sich der Literatur von Ali Smith hinzugeben.
Mit unglaublicher Leichtigkeit beschreibt die Schottin Smith unser
reales Leben zwischen Pflegeheim und absurden Behördengängen, drohender
Arbeitslosigkeit und Verzweiflung, aufkeimendem Nationalismus und
Hassparolen. Aber die Literatur erscheint als realer Ausweg oder besser
gesagt: Umweg in einen Denkraum hinein, in ein Reich des Denkbaren, aus
dem der Weg schnurstracks zurück in die Realität führt. Dabei erzählt
Smith mit so viel klugem Humor, dass man das Buch gleich ein zweites Mal
lesen möchte. Aber es folgen ja bald noch Winter, Frühling und Sommer, auf Englisch längst schon erschienen.
Ines Lauffer, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt
Dietmar Dath
Neptunation
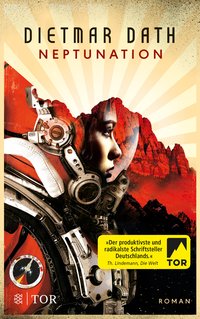
16,99 €
978-3-596-70223-7
oder Naturgesetze, Alter!
„That was some deep shit.“
Zuerst: Der Plot ist kompakt, lässt sich gut verarbeiten, passt in jeden Schädel. Der an Space-Odysseen gewöhnte Science-Fiction-Fan ist sofort daheim, die Struktur ist bekannt. Allein die Machart, mehr, das Füllsel, das Dietmar Dath zwischen den Handlungsfäden aufhäuft, ist dazu angetan, Horizonte und Hirne zu sprengen.
Der Reihe nach: Eine geheimnisvolle, stramm kommunistische Powerfrau ist drauf und dran, ein Team für eine Weltraummission zusammenzustellen. Ausgesucht werden freilich nur die geistig Exzellenten, ein bunter Haufen freakiger Naturwissenschaftler, ein brillanter Linguist mit einer mit der Mission besonders verknoteten Familiengeschichte und ein rüstiger Haudrauf von der Bundeswehr – ohne martialisches Schlappmaul mit Erfahrung im Kampf gegen außerirdische Scherenroboter läuft schließlich kein Raumschiff vom Stapel.
Die Mission nun, zu der diese extrem amüsante und vor allem zu geistigen und intellektuellen Höhenflügen neigende Schicksalsgemeinschaft zusammengewürfelt wurde, lässt sich wie folgt beschreiben: Kurz vor dem endgültigen Zerfall des Ostblocks hat man sämtliches Restgeld zusammengekratzt, um eine letzte, bombastische Raummission zu starten. Ziel des kommunistischen Himmelfahrtskommandos war der äußerste bekannte Planet unseres Sonnensystems, Neptun. Zwei Raumschiffe wurden entsandt, die sich im All zu einem vereinigen sollten, was tatsächlich nie passierte. Eines der Schiffe strandete nämlich in einem Asteroidengürtel, wo sich im Verlauf der Jahre eine technisch hochstehende Zivilisation – die Dysoniki – entwickelte, kommunistisch selbstredend, die bis heute mit ausgewählten Genossen auf der Erde Kontakt hält. Das andere Schiff setzte seine Reise zum Neptun fort und ward fürderhin nicht mehr gesehen. Hörensagen, ein bisschen Legende und ein kryptisches Schreiben ist alles, was von der Fähre geblieben ist. Und um ebendieses irgendwo im, am, um den Neptun verlorene Raumschiff geht es: die Truppe soll den Verbleib und das Schicksal der Verschwundenen klären.
Was für ein gigantisches Spektakel! Während Dietmar Dath sein illustres Personal vorstellt, einen extraterrestrischen Mordanschlag in heißer Actionfilmmanier abfährt, die Raummission und die Geschichte überhaupt voran peitscht, passiert etwas, das den Leser immer wieder aus dem so nett gespannten Bogen der Story kegelt: Sein kognitiv hochgerüstetes Personal unterhält sich nämlich – aber wie! Munter wird da über Musik geplaudert – die Science-Fiction-Oper „Aniara“ von 1959 erfährt da besondere Weihen –, die Linguistik wird fach- und sachkundig beackert und selbstverständlich immer wieder die Mathematik, die Physik und natürlich die Philosophie. Ausgebremst wird der eilige Leser damit, aber auch reich belohnt, denn diese feine Szene, die im Stile eines antiken Dialogs daherkommt, in dem zwei gleichberechtigte Sprecher von unterschiedlichen Standpunkten aus über eine Sache sprechen und beiden bewusst ist, dass es keine definitive Antwort geben wird, ist eines der vielen Filetstückchen des Buches, das so herrlich die Debatten unserer Zeit aufgreift und im Weltall – dem Ort mit dem Überblick, wie eine Figur so treffend feststellt – verhandelt.
Kapital kann man aus dieser Lektüre schlagen, und zwar reichlich. Zugegebenermaßen, die Synapsen glühen, die durchschnittliche naturwissenschaftlich-mathematische Bildung wird bis über die Belastungsgrenze hinaus strapaziert, weil immer wieder noch eine Erläuterung über Wahrscheinlichkeiten, über die Kolmogorow-Komplexität usw. durchexerziert wird. Aber das Ganze ist dann doch eine grandiose Hochleistung des Genres: Wissenschaftliche Fakten werden neu arrangiert, kombiniert, zusammengeschnitten und um eine Gourmetprise Fiction erweitert, sodass einerseits eine phantastische, fast schon „verlässliche“ Story dabei herausspringt, andererseits ein Funke der Begeisterung überspringt, mit der Dath da ans Werk geht. Man möchte weiterdenken, was da geschrieben steht, und hat die süße Gewissheit, dass man kaum jemals heiterer auf seine Wissenslücken hingewiesen wurde!
Johannes Fischer, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt
Michael Köhlmeier
Wenn ich wir sage

Freundschaft, Familie, Nation: Diese drei Bereiche unseres Lebens formen den Begriff des Wir, so die These, die Michael Köhlmeier seinem Essay voranstellt. Doch was genau meint ein Wir im Kontext von Freundschaft oder Familie? Wie instrumentalisieren Nationen das Wir? In mäandernden Annäherungen, klugen Fragen und blitzlichternden Gedanken zeichnet Köhlmeier ein Vexierbild des Wir, das auch eigenen Assoziationen Raum lässt.
Wortbetrug oder auch Begriffswäsche sind mit im Spiel, wenn Nationalisten die Wärme, die das Wir der Heimat ausstrahlt, auf die abstrakte Größe der Nation übertragen. „Das Wir der Heimat bestimmt, wer dazugehört; das Wir der Nation, wer nicht dazugehört. Die Heimat schließt ein, die Nation schließt aus.“
Doch gibt es überhaupt ein Wir aller Menschen? Können wir das Wir wollen oder ist es naturgegeben? Ein Produkt der Kultur vielleicht? Köhlmeier bezieht im Fragen wie im Antworten Gedanken von Michel de Montaigne und Ralph Waldo Emerson mit ein. Keiner der beiden Philosophen legt in seinen Schriften Begriffe unwiderruflich fest, und das mag einer der Gründe sein, warum sie und ihre Bücher Köhlmeier zu Freunden geworden sind. Das Wir in der Freundschaft wird in seinem Essay übrigens zu einem durchaus bedenkenswerten Moment. Denn wann meint dieses Wir zwei Menschen auf Augenhöhe? Ist in Freundschaften nicht immer wieder der eine oder der andere in der Position des Überlegenen?
Was lässt sich noch alles in der Fülle des Wir fassen? Wir bedeutet alles, was nicht fremd ist. Wenn ein Wir zum Zwang wird – in einer Familie kann dies schnell geschehen – wird die Abgrenzung vom Wir gleichermaßen qualvoll wie überlebensnotwendig. Von großer Leichtigkeit und Intensität ist das Wir, das aus einer gemeinsamen Tätigkeit wie etwa dem Musizieren erwächst. Und überaus schmerzhaft kann ein Wir sein, wenn es den gemeinsamen Verlust eines geliebten Menschen miteinschließt.
Michael Köhlmeier ist dies geschehen, er spricht es aus, gibt sich in diesem Essay immer wieder zu erkennen. Damit relativiert er seine Gedanken zum Wir, macht sie zu persönlichen Beobachtungen – die deswegen nichts von ihrer Klugheit und Relevanz einbüßen – und fordert zum Weiterdenken auf. Unruhe bewahren meint nichts anderes als das.
Susanne Rikl, München
Alexander Osang
Die Leben der Elena Silber
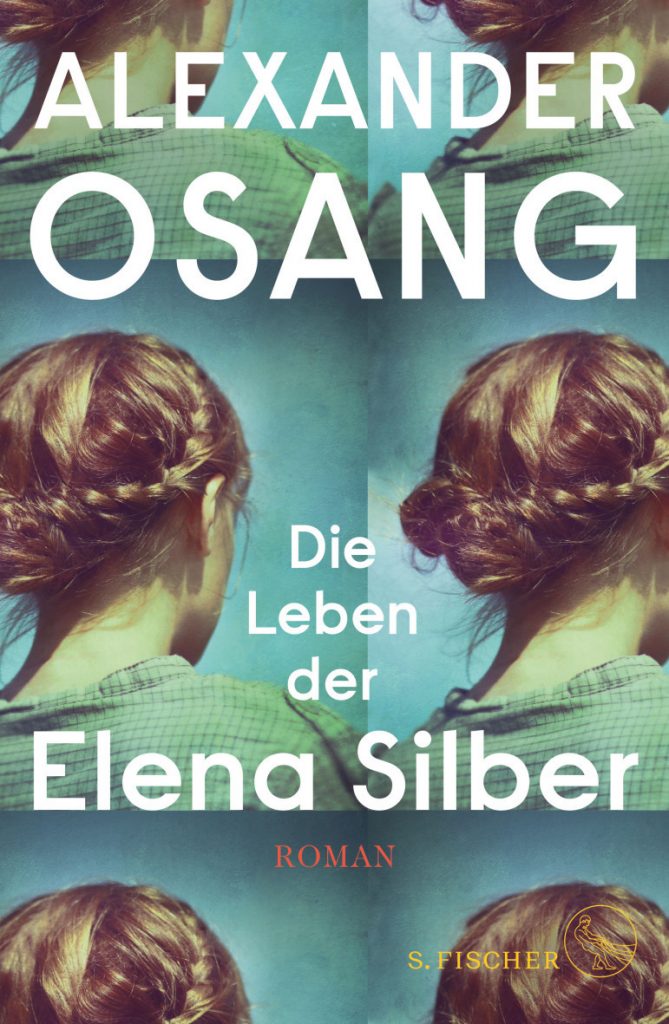
Preis 24,00 EUR
Jelena Krasnow ist noch keine drei Jahre alt, als man ihren Vater mitten im russischen Winter in der kleinsten Stadt Russlands pfählt. Wir schreiben das Jahr 1905, noch wartet Jelena an der Schwelle des Hauses auf die Heimkehr des Vaters, noch läuft sie mit dem leeren Korb in Händen, um Holz für den Ofen zu holen, als ein Freund auf den Hof gerannt kommt. Atemlos berichtet er von dem Blutbad, das der Mob angerichtet hat: Gepfählt ist nicht nur Viktor Krasnow, ermordet ist auch der Freund, erschossen auch der Arzt, der sie retten wollte – und Jelena Krasnow flieht zum ersten Mal in ihrem Leben. Wenn wir nach 600 Seiten das Buch von Alexander Osang wieder zuschlagen, wird Jelena noch etliche weitere Male geflohen sein und jedes Mal einen Teil ihres Namens verloren haben: Jelena, Elena, Lena – es sind Die Leben der Elena Silber, geborene Krasnow.
Was Alexander Osang hier erzählt, ist weder ein Einzelschicksal noch eine unerhörte Geschichte. Das gesamte 20. Jahrhundert ist eine Geschichte der großen Flüchtlingsströme. Aber wie Osang die Leben der Elena Silber erzählt, das ist tatsächlich großes Kino. Osang möchte nicht experimentell sein, er möchte nichts Außergewöhnliches präsentieren, die Realität selbst ist verworren und tragisch genug, die Frage nach Täter und Opfer nicht immer zu beantworten.
Als Jelena Mitte zwanzig ist, lernt sie den deutschen Ingenieur Robert Silber kennen, der vom stalinistischen Russland angeworben wurde, um die Netzfabrik auf Vordermann zu bringen. Sie verlieben sich, sie heiraten, sie gründen eine Familie. Vom kleinen Fluss Oka, an dem ihr Heimatdorf Gorbatow lag, zieht Jelena weiter an die Wolga, an die Moskwa und an die Newa, hier kommen drei ihrer fünf Mädchen auf die Welt, bevor Jelena – wir schreiben mittlerweile das Jahr 1936 – wieder fliehen muss, und der Fluss in der neuen Heimat heißt Spree. Statt im stalinistischen Russland lebt die Familie nun im faschistischen Deutschland, dem selbst wiederum Tausende entfliehen. Ein weiteres Mal und noch ein weiteres Mal und dann nochmals wird Jelena Silber umziehen und fliehen, von Sorau nach Pirna und schließlich nach Berlin.
Auf der letzten Flucht ist ihr Mann abhanden gekommen, getürmt oder ermordet oder in Kriegsgefangenschaft geraten, niemand weiß es. Von ihren fünf Töchtern hat Elena Silber zwei überlebt, die kleine Anna starb an Tuberkulose, die tapfere Vera brachte sich um. 1947 war sie es noch gewesen, die die Familie vor dem Tod bewahrte, als Jelena nicht mehr weiterwusste: Sie war mit ihren vier Töchtern im Flüchtlingsheim in Pirna untergekommen, das nur ein paar Jahre zuvor noch Tötungsanstalt für „unwertes Leben“ war. Im Keller lagerte noch das Gift, das nun die Odyssee ihrer Familie beenden sollte. Aber hatte Jelena nicht selbst ihr Kindermädchen in Sorau in den sicheren Tod geschickt, als sie sie nach dem Tod der kleinen Anna entließ? Im Wald lag das Frauenlager Christianstadt. Und war nicht der eigene Mann ein Nazi?
Alexander Osang erzählt in großen Abschnitten aus der Perspektive des Enkels Konstantin Stein aus dem Jahr 2017. Stein ist wie schon sein Vater Filmemacher und vergeblich auf der Suche nach Stoff für einen neuen Film. Schon sein Vater stand – noch zu DDR-Zeiten – hinter der Kamera, drehte Tierfilme, denen regelmäßig systemkritische Botschaften angedichtet wurden. Mittlerweile ist er im Pflegeheim, das Gedächtnis dement.
Es sind die großen Themen des 20. Jahrhunderts, die beinahe nebenbei aufgeworfen werden in diesem Roman, der eben deshalb so eindrucksvoll ist, weil er trotz allem großen Kino, das er liefert, eigentlich sehr bescheiden ist: Natürlich, weiß der Erzähler, bleiben die Leben der Elena Silber letztlich ungreifbar.
Ines Lauffer, autorenbuchhandlung marx & co
François Augiéras
Eine Reise auf den Berg Athos
Aus dem Französischen von Dirk Höfer
„Was ist das für ein Dorf, wo ich nur Kinder, blutjunge Frauen und Mädchen zu Gesicht bekomme?“ Am Strand von Ierissos, ganz im Osten Griechenlands, spaziert, im Schatten der Eukalyptusbäume, ein junger Toter. Unsicher befragt er seine Begleiterin, wo er sei und wie sich die anderen Toten in seiner Situation verhielten. Wenige, ist die Antwort, wagten die Weiterreise auf den heiligen Berg. Die meisten machten nur kurz Station, um dann wieder ins Reich der Lebenden zurückzukehren.
Der tiefblaue Himmel wölbt sich über dem Dorf, dem weiß leuchtenden Strand aus feinem Sand. Mädchen lachen in den verwunschenen, üppigen Gärten. Gedämpftes Geplauder dringt aus den verschatteten Weinlauben, Kinder spielen ausgelassen. Wie leicht, sich hier zur Rückkehr ins Leben zu entscheiden. Süße Verheißung.
Der junge Tote allerdings will das Jenseits erkunden, das
von einem marmornen Berg überragt wird, in dessen dunklen nach
Zedernholz duftenden Urwäldern Schlangen und wilde Stiere hausen. In dem
in verschwiegenster Gottesfurcht zweitausend Mönche in zwanzig Klöstern
und einigen Einsiedeleien leben. Ein Jenseits, das die Identität wie
die Zeit infrage stellt, auflöst und dessen Erkundung vielleicht zu
höheren Wahrheiten führt.
Leicht wehmütig nimmt der Tote Abschied von seiner Begleiterin, versorgt
sich mit dem Nötigsten und setzt mit dem nächsten Boot über, um eine
rastlose Wanderschaft auf dem Athos zu beginnen – eine fiebrige Reise
zwischen Ich-Auflösung und staunender Naturbetrachtung, zwischen Askese
und sexueller Ausschweifung, spiritueller Einsicht und gleißendem
Wahnsinn.
Der Heilige Berg Athos ist die einzige Mönchsrepublik der Welt. Eintausendachthundert orthodoxe Mönche leben weltabgewandt auf der schmalen Halbinsel, die im Osten an Chalkidiki anschließt. Frauen ist der Zutritt verboten, weibliche Tiere sind ebenfalls untersagt. Es heißt: Die Abwesenheit alles Weiblichen wird durch die Anwesenheit der Gottesmutter kompensiert und gereiche so dem Weiblichen zur höchsten Ehre.
Der Athos ist autonomes Gebiet und wird von den Äbten der Klöster verwaltet. Dass dieses Gebiet als besonders geheimnisvoll, als Sehnsuchtsort spiritueller Erfüllungen gilt, dass sich Jahr um Jahr Pilger entschließen, dieses unwahrscheinliche Stück Erde zu erkunden, ist naheliegend.
Und so machte sich auch der französische Schriftsteller François Augiéras in den 50er-Jahren auf den Weg, den Athos für sich zu entdecken. Wie lange er die Mönchsrepublik durchstreifte, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass er seine Erlebnisse in seinem rätselhaften Buch Eine Reise auf den Berg Athos einfließen ließ, in dem er beschreibt, wie ein junger Toter in das Jenseits des Athos kommt, rastlos von Kloster zu Kloster wandert, dabei mehrere Identitäten durchlebt, weil er seiner eigenen durch seinen Tod verlustig gegangen ist und schließlich nach spiritueller Veredelung in radikaler Entsagung sucht. „War ich tot? Träumte ich? Meine Abenteuer auf dem Heiligen Berg waren nur die Folge meiner Neigungen und meiner früheren Leben.“
Im gleichen Maße wie sich die Identität des toten Protagonisten im Laufe seiner Wanderschaft auflöst, wie er zu der Überzeugung gelangt, dass seine Seele eine Vielzahl von Identitäten beheimatet, die er beinahe beliebig wechseln kann, erodiert der Text Genregrenzen und sperrt sich einer genauen Zuordnung: kristallklare Naturbeschreibungen von ausnahmsloser Schönheit und Präzision wechseln mit der Schilderung beinahe mythologischer Szenen ab, spirituelle Gedankengänge, die pantheistische, christliche und buddhistische Ideen in ein religiöses Mash-up verwandeln, münden in sexuelle Eskapaden mit deprivierten Athos-Mönchen. All das wird von der Ungewissheit verrätselt, ob der Protagonist tatsächlich durch das Jenseits wandert oder aber ob er nur von einem Jenseits der regulären Welt spricht, dem Athos als spirituelle Sphäre also, in der die ultimative Selbsterfahrung möglich ist, weil dieses Gebiet dem normalen Lauf der Welt nicht folgt.
„Hinter den Pforten des Todes reichte ein Nomadenlager zu meiner Erquickung aus, denn ich war ein uralter Geist. Meine Einsamkeit, keineswegs dazu angetan, mich zu quälen, gab mir mein wahres, aus Urzeiten stammendes Wesen zurück.“
Ganz gleich welchem Genre man dieses Werk zuordnen möchte, ganz gleich, welche Intention der frühverstorbene Augiéras, der gegen Ende seines Lebens in einer Höhle bei Domme im Périgueux hauste, mit der Niederschrift dieses Textes auch hatte: Die Reise auf den Berg Athos ist ein außergewöhnliches, skurriles Buch, das dank seiner vorzüglichen und feinen Sprache einen Kosmos aus glänzenden, manchmal irre schillernden Bildern entstehen lässt, der irgendwo zwischen psychotischem Wahn und höchster poetischer Kunst angesiedelt ist.
Johannes Fischer, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt
Anne Carson, Rot
Zwei Romane in Versen
Aus dem Amerikanischen von Anja Utler
Das Aufgreifen antiker Stoffe und Figuren ist in der Literatur der Gegenwart und jüngerer Vergangenheit kein unbekanntes Phänomen. Nichtsdestotrotz kann der Zugang, den Anne Carson wählt, nicht nur als neu, sondern auch als einzigartig beschrieben werden. Rot erzählt die Geschichte von Geryon und Herkules. Eine Liebesgeschichte, ein Coming-of-Age Roman, ein Reisebericht und Mythos, aber vor allem ein ungezügeltes Spiel der Sprachbegeisterung von einer Autorin, die in Kanada und den USA bereits zu den wichtigsten Autor*innen der Gegenwart gezählt wird.
Der Mythos, nach welchem Herkules Geryon tötet und dessen Rinderherde entführt und so die zehnte seiner Aufgaben erfüllte, findet sich nur im Vorwort in Carsons eigener Übersetzung des Stesichoros Fragments wieder. Wenn man, um einen ernsthaften Umgang mit dem, was uns von der Antike überliefert ist, auf das Wort (Original-)Treue zurückführen möchte, so gilt diese bei Carson nicht den äußeren Umständen des Mythos. Spielend überführt sie das Schicksal Geryons in das New York City der Gegenwart, wird aus dem Mörder, der unerreichbare Geliebte. Die Freiheiten, die Carson sich in Bezug auf die Neuerzählung nimmt, liegen indes weniger in einer Abwendung begründet als in der konsequenten Weigerung, die Antike und ihre Dichtungen als etwas Versteinertes und Lebloses wahrzunehmen. Dieser Umgang ist auch in Carsons altphilologischen und wissenschaftlichen Arbeiten und Übersetzungen immer wieder lobend hervorgehoben worden. Verbindlich erscheinen für Carson vielmehr die Stimmung und die Poetik des Mythos. Geht Carson über einige Aspekte des Mythos achtlos hinweg, so ist doch ihr Umgang mit ihren Figuren von extremer Einfühlsamkeit geprägt, die an Distanzlosigkeit grenzt.
So wenig zurückhaltend wie Carsons Umgang mit ihren antiken Figuren ist, so kompromisslos und ausladend ist auch ihre Sprache. Der bemerkenswerten Übersetzung der Lyrikerin Anja Utler gelingt es, auch im Deutschen die Leichtigkeit des an Metaphern reichen Stils zu erhalten. Die neue Ausgabe bei S. Fischer führt außerdem erstmals die zwei Romane über Geryon, die von der Autorin mit einem Abstand von 15 Jahren verfasst worden sind, in einem Buch zusammen. Die direkte Gegenüberstellung der beiden Romane ist sehr reizvoll. Sie führen Carsons ununterbrochene Begeisterung für die sich verwandelnde Form und das experimentierende Erzählen vor und machen deutlich, dass auch in Rot der Mythos etwas genuin Lebendiges und Unstetes bleibt. Besonders reizvoll ist die in unterschiedlicher Ausprägung sich durch beide Romane ziehende Versform. Dabei verzichtet Carson auf jede Form des Metrums oder des Reims. Lediglich die abbrechenden Zeilen unterscheiden den Text von Prosa. Der Effekt ist ein doppelter: der Text bleibt flüssig und leicht zu lesen, während seine Setzung die Tragweite des einzelnen Satzes betont.
Das Ineinandergreifen von Prosa und Poesie ist zentral für Carsons gesamtes Werk und das Verhältnis der beiden zueinander bleibt so dunkel und unverständlich, wie Carsons eigenes Zitat, das von ihren Verlegern aus gutem Grund auf Rücken und Einband des Buches gedruckt wurde: „was unterscheidet die Poesie von der Prosa Sie kennen die alten Analogien die Prosa ist ein Haus die Poesie ein Mann in Flammen der ziemlich schnell hindurchrennt“.
Theresa Mayer, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt
Zeichnen für ein Europa
Bilder von 45 Illustratorinnen und Illustratoren. Aus dem Englischen von Fabienne Pfeiffer
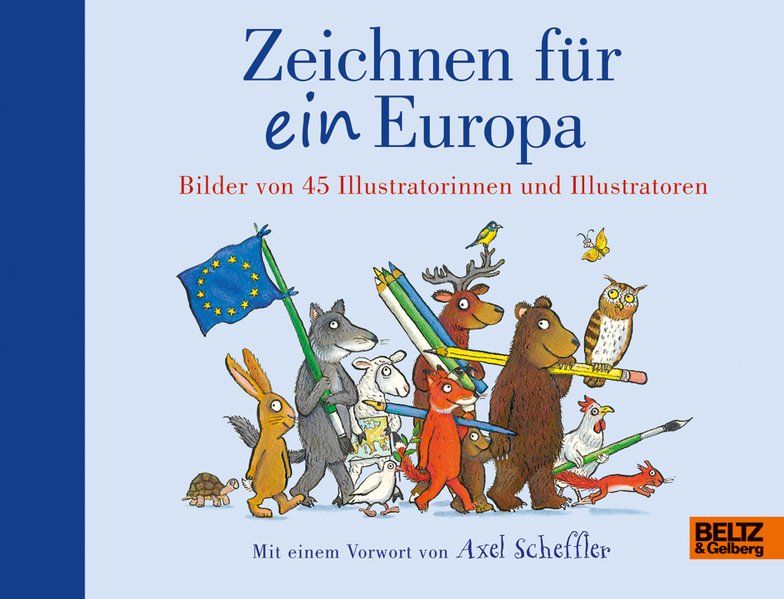
978-3-407-81247-6
Dieses Buch gehört zu jenen Büchern, bei denen wir Buchhändler*innen mal wieder nicht so genau wissen, wohin wir es eigentlich stellen sollen. Gehört es in unsere Kinder- und Jugendbuch-Ecke, weil es bunt ist und uns naturgemäß viele der Figuren bekannt vorkommen – immerhin illustrieren die Mitwirkenden sonst vorwiegend Kinderbücher? Oder sind die in ihm enthaltenen Zeichnungen von 45 Illustrator*innen nicht viel zu hintersinnig, ironisch, anspielungsreich, um für Kinder geeignet zu sein? Gehört es gar ins Politik-Regal, weil Europa und seine Zukunft vermeintlich auf dem politischen Parkett zwischen Parteien und Wahlprogrammen ausgehandelt wird?
Die ursprüngliche Idee zu diesen 2017 entstandenen, bebilderten Reflexionen über Europa stammt von Markus Weber, dem Leiter des Frankfurter Moritz Verlags. Er bat die Illustrator*innen der in seinem Haus erscheinenden Kinderbücher, ihre Gedanken zu Europa aufs Papier zu bringen. Die damals entstandenen Bilder aus fünf europäischen Ländern wurden auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert, dann im Berliner Bundesministerium für Arbeit und Soziales ausgestellt und später versteigert. Doch die Idee ging auf Wanderschaft, und viele weitere Illustrator*innen, insbesondere auch aus Großbritannien, nahmen Papier und Stift zur Hand, um ihrem Glauben an Europa oder ihrer Kritik am Brexit bildreich Ausdruck zu verleihen.
Ob in Form einer mit 12 gelben Sternen jonglierenden Kuh von Kristina Andres („Genau wie beim Jonglieren muss Europa viel üben, damit es klappt“) oder als zirkusreif balancierende, Fahnen schwenkende Tiere auf einem schwarzen Stier von Thé Tjong-Khing („Die Europäische Union als schwieriger Balanceakt“), fast überall ist unübersehbar, dass Europa mehr ist als eine heterogene Gruppe von Ländern. Auffällig oft stellen die Illustrator*innen die Länder Europas als spielende Kinder dar. Und vielleicht ist das die hoffnungsvollste Deutung der aktuellen Europäischen Union: Kinder, die spielerisch und kreativ lernen, miteinander auszukommen, Kompromisse zugunsten der Gruppe einzugehen und ihre Unterschiede als Stärken zu erkennen. Der deutsche Illustrator Andreas Német stellt den Leser*innen gar eine Europakarte zur Verfügung, die nur aus Länderkürzeln besteht und auf den ersten Blick an „Malen nach Zahlen“ erinnert. Német fordert auf, die persönlichen Verbindungen zu und zwischen den einzelnen Ländern selbst einzuzeichnen. Hier wird vielleicht besonders klar, dass jeder von uns mitbestimmt, was Europa heute und in Zukunft für uns ist oder werden kann.
In witziger, aussagekräftiger und oft subtil nachdenklicher Form regt dieses Büchlein – vielleicht gerade jetzt, kurz vor der Europa-Wahl am 26. Mai – zum Nachdenken und Sprechen über Europa an. 45 europäische Ideen sind hier, ganz wie Europa selbst, in Vielfalt vereint!
Larissa Siebicke, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt