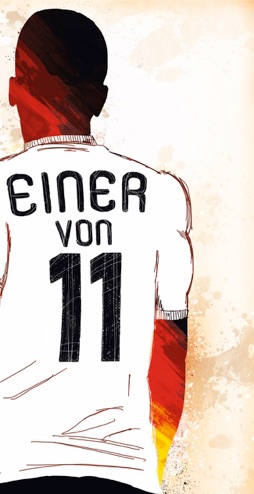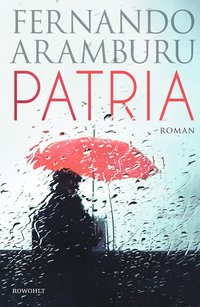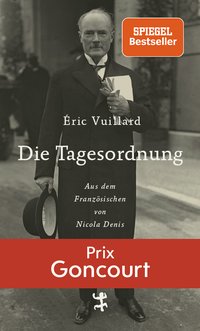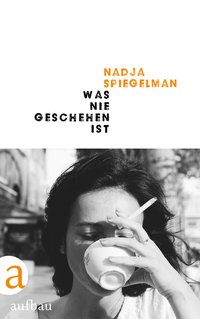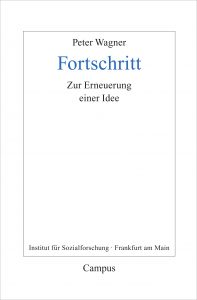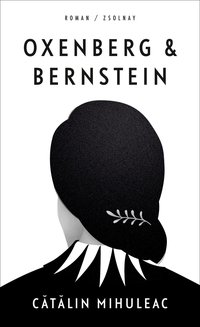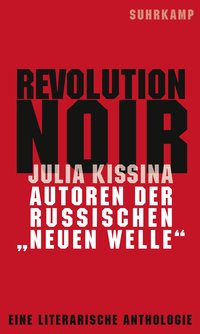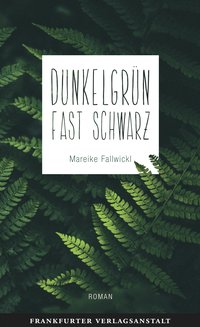Robert Seethaler -Das Feld
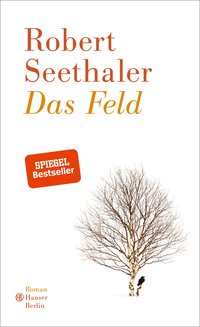
978-3-446-26038-2
Robert Seethaler hat die große Fähigkeit, fesselnde und berührende Romane über gänzlich unspektakuläre Menschen zu schreiben. Seine Protagonisten sind keine strahlenden Helden, keine Gefallenen, sie erleben keine schicksalsträchtigen Dramen, keine Liebespassionen, haben aber mit dem, was ihnen das Leben zumutet, genug zu tun. Sie leben ihr Leben, und der staunende Leser ist zutiefst beglückt, ihnen dabei folgen zu dürfen. Sein neuer Roman hat nicht einmal mehr eine Hauptperson. Hier kommen Menschen zu Wort, die zumeist wenig miteinander verbindet – außer dem Ort, an dem sie oder zumindest ihre Körper sich befinden: dem ältesten Teil des Paulstädter Friedhofs, „das Feld“ genannt.
Hierhin kommt jeden Tag ein Mann, läuft zwischen den Gräbern umher, setzt sich auf eine Bank und hört ihre Stimmen. Neunundzwanzig Tote, dreißig Stimmen. Denn der Erzähler lebt, und die Toten erzählen aus ihrem Leben: eine kurze Begebenheit, einen Moment des Glücks, Leid, Schicksalsschläge. Eine ganze Erzählung oder einen Absatz lang, einmal auch nur ein Wort. Manche kannten sich näher, manche nur vom Sehen, einige waren Paare, andere stehen gänzlich für sich. Einer erlebt, dass man auch als Toter noch verlassen werden kann. Eine Frau erzählt von der siebenundsechzig Tage währenden Freundschaft zu der uralten Henriette, der sie nur sechsundzwanzig Tage später in den Tod folgt. Ein Pfarrer spricht darüber, wie eine Berufung zum Fluch wird, ein Vater gibt seinem Sohn aus dem Grab heraus (gute?) Ratschläge. Ein Briefträger erinnert sich an seine Tour, ein Bürgermeister schwadroniert von seinen (Un-) Taten. Nach und nach verdichten ihre Erzählungen sich zu einem vielfältigen Chor, in dem jede Stimme ihre eigene Melodie singt, alle zusammen sich dennoch zu einem Ganzen vereinigen – einem Chor der Toten, die das Leben erzählen. Das schrammt auch schon mal hart am Kitsch vorbei, aber Seethalers unnachahmlich lakonischer Tonfall verhindert zuverlässig ein Abrutschen.
Dieses Buch liest man nicht an einem Stück durch und ist dann fertig. Manchmal reicht ein kurzer Absatz, der noch lange nachklingt, eine überraschende Wendung lässt innehalten und das Buch erst einmal hinlegen. Aber anders als bei Erzählungen, bei denen es oft unbefriedigend ist, wenn man die gerade gelesene mit der nächsten gleich wieder wegwischt, entsteht hier eine Verbindung zwischen den Personen. Man begegnet den gleichen Namen öfter, immer in anderen Zusammenhängen, und es entsteht eine Vertrautheit, die sich im Laufe der Lektüre verstärkt. Obwohl jede Erzählstimme aus dem Totenreich kommt, ist Das Feld kein trauriges oder niederdrückendes Buch – es ist das pralle Leben. Es ist so, wie der Erzähler im Buch sagt: „dass der Mensch vielleicht dann erst endgültig über sein Leben urteilen konnte, wenn er sein Sterben hinter sich gebracht hatte.“
Ruth Roebke, Bochum